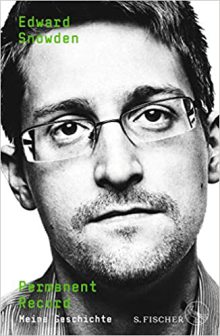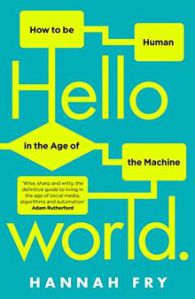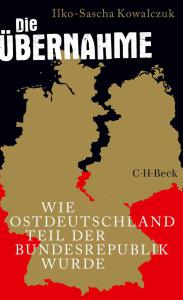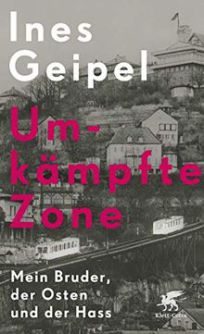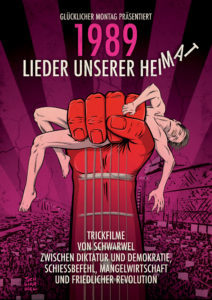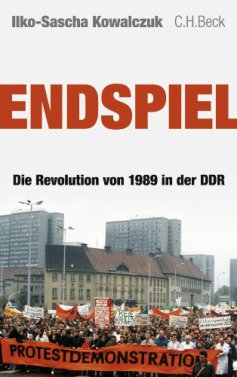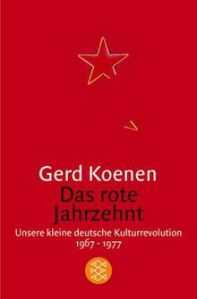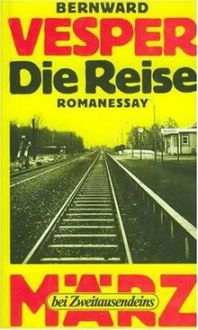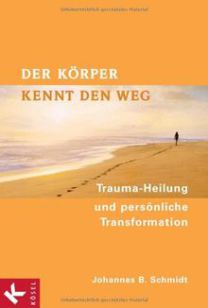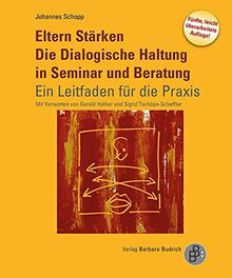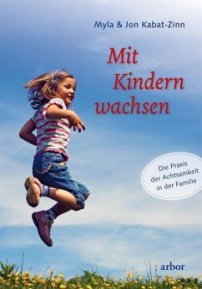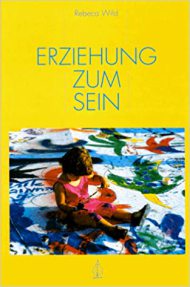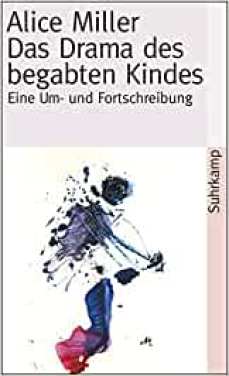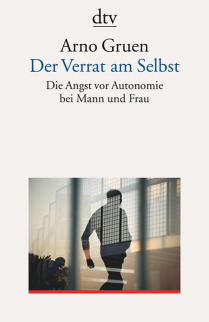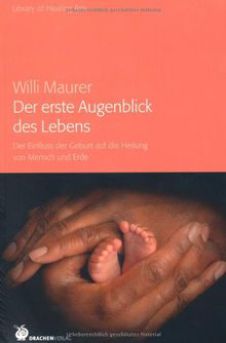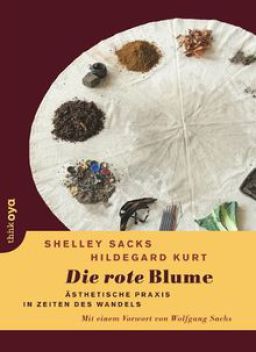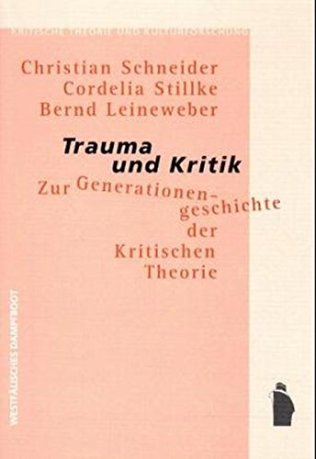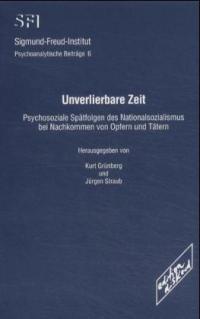Präferenzen
Kleine Auswahl empfehlenswerter Webseiten & Bücher
Ihr Projekt auf gutem Kurs. Wir unterstützen Sie in der Umsetzung Ihrer IT-Projekte. Martin Apitz. https://artmin.de
Business Quest. Professionelle Prozessbegleitung für Unternehmen bei Umbrüchen und Übergängen. Gesa Heiten. https://www.businessquest.de
Im Dialog. Willkommen auf den Seiten von Johannes Schopp. http://johannes-schopp.de
Atelier Wandlungen. Inka Gierden und Julien Collieux. http://www.atelier-wandlungen.de
Mit meiner Arbeit würdige ich Menschen in Übergängen. Ina Deicke. https://www.inadeicke.de/ina-deicke/
Somatische Akademie Berlin. https://www.somatische-akademie.de/index.php
Einwende. Wie Medien auf Ostdeutschland schauen. https://einwende.de
Zeitenwende. Lernportal zur Zeitzeugenarbeit. https://zeitenwende-lernportal.de
Der lange Schatten der Stasi-Überwachung. Andreas Lichter, Max Löffler und Sebastian Siegloch belegen im Jahr 2016 langfristige psychosoziale und wirtschaftliche Folgen. https://econpapers.repec.org/article/cesifodre/v_3a23_3ay_3a2016_3ai_3a05_3ap_3a08-14.htm
Die NSA entwickelte zahlreiche Tools, um den Internetverkehr zu überwachen. Ein digitales Werkzeug, das dabei besonders stark in die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern eindrang, hieß Turbulence. Damit konnte die Behörde jede URL weltweit prüfen. Tippte jemand etwa google.com in den Browser ein, durchlief diese Anfrage auch Server in Telekommunikationsfirmen und Botschaften. Ein weiteres Werkzeug namens Turmoil sammelte diese Daten – abgesehen von der URL etwa das Land, aus dem die Anfrage gestellt wurde. Schien irgendetwas verdächtig, wurde die Anfrage weiter an das Werkzeug Turbine geleitet, das sie auf die Server der NSA verwies. Automatisiert wurden dann Exploits, also Schadprogramme, mit der URL an den Nutzer geschickt. Während der also dachte, er würde schlicht Google abrufen, konnte die NSA von nun an alle seine Daten überwachen. So beschreibt es Snowden. Massenüberwachung per Mausklick.
Nur warum schien das außer Snowden niemand bei der NSA fragwürdig zu finden? Wie konnte es sein, dass niemand früher an die Öffentlichkeit ging? Zwar skizziert der Whistleblower in seinem Buch durchaus einzelne Verstöße, die Mitarbeiter begingen oder von denen sie wussten. Erzählte er seinen Kollegen von seinen Bedenken, erntete er oft nur ein Schulterzucken: "Was will man machen?"
Vielleicht war ihnen das Ausmaß der Überwachung gar nicht bewusst. Kein einzelner Agent habe jemals einfach zufällig während seiner Tätigkeit von allen Aktionen etwas mitbekommen können, schreibt Snowden. Auch weil die auf vielfältige technische Art und Weise begangen wurden. "Um auch nur die Spur einer strafbaren Handlung zu entdecken, musste man danach suchen. Und um danach suchen zu können, musste man wissen, dass es sie gab."
("Weil sie wissen, was sie tun." Rezension auf Zeit-Online, 17.09.2019, https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2019-09/permanent-record-edward-snowden-whistleblower-cia-nsa-autobiografie-rezension)
Edward Snowden: Permanent Record – Meine Geschichte. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019.
You are accused of a crime? Who would you rather decides your future – an algorithm or a human?
Before making your decision, bear in mind that the algorithm will always be more consistent, and far less prone to an error of judgement. Then again, at least the human will be able to look you in
the eye before determining your fate. How much fairness would you be willing to sacrifice for that human touch?
This is just one of the dilemmas we face in the age of the algorithm, where the machine rules supreme, telling us what to watch, where to go, even who to send to prison. As increasingly we rely on
them to automate big, important decisions – in crime, healthcare, transport, money - they raise questions that cut to the heart of what we want our society to look like, forcing us to decide what
matters most. Is helping doctors to diagnose patients more or less important than preserving our anonymity? Should we prevent people from becoming victims of crime, or protect innocent people from
being falsely accused?
Hannah Fry takes us on a tour through the good, the bad, and the downright ugly of the algorithms that surround us. In Hello World she lifts the lid on their inner workings, demonstrates
their power, exposes their limitations, and examines whether they really are an improvement on the human systems they replace.
Hannah Fry: Hello world. How to be Human in the Age of the Machine. Doubleday; London, New York, Toronto... 2018
Ich gebe gerne zu, dass mir im Schreibprozess die Wucht der ganzen deutsch-deutschen Schieflagen selbst etwas übertrieben vorkam - ich kann sie nicht ändern, sie stellen eine Realität dar. Hinzu kommen Bürden und Herausforderungen, die weit über Ostdeutschland hinaus von Bedeutung sind: Lasten der Geschichte, unaufgearbeitete Vergangenheiten und Probleme, die sich aus der Globalisierung ergeben. Erst in diesem Kontext erscheint Ostdeutschland, die Grundthese dieses Essays, bei allen Besonderheiten und Spezifika als Laboratorium der Globalisierung: Der raschen nachholenden Modernisierung der 1990er Jahre mit ihren dramatischen sozialen und kulturellen Folgen folgte bald eine Entwicklung, die sozial, politisch und kulturell dem Westen nur einige Schritte voraus zu sein scheint, und das ist nicht unbedingt als Beruhigung gedacht.
Ilko-Sascha Kowalczuk: Die Übernahme: Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. C.H. Beck Verlag, München 2019 (hier S. 23.).
Man kann sicherlich einiges über die verordneten Schweigezonen sagen, über das politische Machtschweigen - über die Moskauer und ihr Stalintrauma, über die roten Buchenwaldler, über die Totenfelder zweier Weltkriege, über Opfer und Täter. Aber am Ende bezieht jedes Schweigen sein Zuhause in einem einzelnen, konkreten Leben und wird zur Erfahrung. Dann werden die Worte einbehalten, um sich zu schützen, vorgetäuscht, um sich harmlos zu machen, kaputt geschwiegen, um etwas nicht spüren zu müssen.
Was sollte sich nach 1989 daran geändert haben? Wie? Wodurch? Gab es nach dem zweiten Zeitbruch nicht noch mehr Gründe zu schweigen? Die Psychologie der Doppeldiktatur in ihrer explosiven Turbulenz, all das Ungeklärte, Weggedrückte, von Generation zu Generation Weitergetragene. Ich denke an Mutter, die inständigste Schweigerin, der ich je begegnet bin. Innehalten, sich leicht wegbücken, warten, unterdrücken, vermeintlich staunen, die Mundwinkel hoch- oder runterziehen, unterlassen oder einfach keine Antwort geben. Ihr Schweigen hatte etwas Atemloses. Verschwegen, wegschweigen, anschweigen, zuschweigen, drüberschweigen, ausschweigen, umschweigen. Es war bestimmt ihr notwendiges System, am Ende ihre Herrschaft, ihr Triumph. (...)
Nach dem Herbst 1989 galt der politische Vosatz: Keine wertvolle Zeit verlieren, es besser machen als nach der ersten Diktatur. Die DDR-Verbrechen sollten möglichst umfassend geahndet werden. Die Voraussetzungen dafür standen nicht schlecht. (...) Trotzdem blieb das Ganze mehr Verlautbarung, als dass es umgesetzt werden konnte. (...)
Die Nullerjahre. Neben äußerem Aufbau, Neukonsolidierung und Bauboom waren das laut Statistik die die Postdiktatur Ost vor allem die Jahre drastisch steigender Gewalt, zunehmender Kinderarmut, einer dreifach höheren Zahl innerfamiliärer Tötungsdelikte als im Westen oder dem um vier Jahre früher liegenden Drogeneinstiegsalter bei Jugendlichen. Verwerfungen, Verleugnungen, Unerlöstes. In das Trauma des Ostens krachte das Trauma der Verunsicherung.
Ines Geipel: Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass. Klett-Cotta, Stuttgart 2019 (hier S. 186; 223; 225).
"Dies ist ein Musik-Video-Episoden-Film, der Jugendlichen einen ganz besonderen Zugang zu DDR-Alltag und Geschichte ermöglichen soll. Möglichst nicht als staubtrockene
Historienerzählung à la 'Opa erzählt wieder vom Krieg'.
Daher haben wir aus der Erfahrung früherer Animationsfilme einen anderen, frischen Stil gesucht, eine ziemlich lehrreiche Vergangenheit nahe zu bringen und dabei auch eine Brücke in unser gemeinsames
Heute zu schlagen. Unser Ziel ist, für all jene, die „damals im Osten“ nicht dabei waren, einen besseren, „privateren“ Zugang zu schaffen, diese rätselhafte DDR und ihren öden Diktaturalltag zu
verstehen, ob in der Schule, an der Grenze oder zu Hause. Es geht jedoch auch darum, den damals Jugendlichen beim Mut-Wachsen zuzusehen um etwas gegen dieses nervende DDR-Grau zu unternehmen.
Herausgekommen ist ein Trickfilm, der das Leben (nicht nur der Heranwachsenden) in einer Diktatur wie der des SED-Regimes in der DDR nachvollziehbar macht. Frustration, Enge, Bevormundung. Eben
Monotonie und Grau trotz vieler Farben, die es natürlich ebenfalls gab. Ich selbst bin in Leipzig aufgewachsen, wo es viele Nischen gab, aber trotzdem keinen ausgedehnten Freiraum. Gleich nach dem
Mauerfall bin ich nach Berlin-Kreuzberg gezogen - das damals irgendwie als nahezu grenzenloser Selbstverwirklichungsraum für Jugendliche galt, vor allem für diejenigen, denen Kunst, Punk und Musik
viel bedeuteten.
Denn Jugendliche wollen nicht nur vielfarbig träumen, sondern auch Träume umsetzen können, die Welt eben nicht nur schwarzweiß sehen (und hören) können, sondern auch
vielfarbig erleben und Frei-Räume genießen können. Diese Sehnsucht zeigt dieser Film. Er will in Bild und Songs ein von uns und anderen erlebtes Lebensgefühl anschaulich machen, wie es sich
anfühlt, wenn dieser Frei-Raum zur Selbstverwirklichung fehlt oder zu eng ist. Umso mehr macht das nachvollziehbar, woraus sich der Frust 1989 nährte, der so viele hier bei uns vor 30
Jahren in Leipzig und anderswo auf die Straße führte. Weil dieser beschränkte Alltag zwar einerseits kreativ gemacht hat, aber andererseits einfach nur frustrierte, wenn man nicht gerade
alltagsblinder Vollblutideologe war.
Kurzum: Für unser Empfinden lässt sich Geschichte am leichtesten erlebbar machen und vermitteln, indem wir uns einfühlen können in Erzähltes, Gesehenes, Gehörtes und Gelesenes. Wenn uns das gelingt,
können wir Rückschlüsse ziehen auf unser eigenes Leben im Hier und Jetzt. Wir können uns damit auseinandersetzen, was Vergangenheit mit uns und unserem eigenen Leben zu tun hat und was wir daraus
mitnehmen können. Genau das möchte unser Film und unsere damit verbundenen Bücher, welche Animation, Comic, Illustration und kurze vertiefende Aufsätze verbinden.
(https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/300693/1989-lieder-unserer-heimat)
Schwarwel: 1989 - Lieder unserer Heimat. Vorwärts immer! Eine Produktion von Glücklicher Montag 2018.
"Ilko-Sascha Kowalczuks Werk ist das gewichtigste unter den wichtigen neueren Publikationen zum Thema – nicht nur, weil seine Studie bei aller nüchternen Präzision der Analyse von einer selten gewordenen Leidenschaft für ihren Gegenstand getragen ist; nicht nur, weil sie eine verblüffende Breite und Intensität bei der Verarbeitung der Quellen an den Tag legt; auch nicht nur, weil das Buch ungemein lebendig und mitunter sehr witzig erzählt (das Kapitel „Zwischentöne“ kann als historiographisch-literarisches Glanzstück gelten).
Der Rang des Werkes wird vor allem dadurch begründet, dass es Kowalczuk gelingt, die in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre einsetzende „politische, gesellschaftliche und kulturelle Krise“ (S. 291), die der ostdeutschen Revolution voraus lag und ohne deren genaue Kenntnis das plötzliche Aufplatzen scheinbar auf ewig betonierter Verhältnisse mysteriös bleiben müsste, in bisher unerreichter Tiefe und Farbigkeit zu erklären. Dabei werden die innen- und außenpolitischen Konjunkturen, ökonomische Blockaden und Malaisen, alternative Subkulturen, treffende Psychogramme, Stimmungen und Unterströmungen in verschiedenen Milieus bis hin zur Ton angebenden Glaubensgemeinschaft SED so miteinander verknüpft, wie das eine wissenschaftliche Krisendiagnose eben tun muss. Sie umfasst mehr als die Hälfte des Buches."
Klaus-Dietmar Henke (https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-13757)
Ilko-Sascha Kowalczuk: Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR. C.H. Beck Verlag, München 2009.
Kurzum, das Bild dieser linksradikalen, kulturrevolutionären Bewegung bleibt schwankend. Vieles, das meiste, was sie bewirkte, geschah entgegen ihren bewussten Absichten und ihren politischen Ideologemen. Aber dem entsprach auch ihre hochgradige Doppeldeutigkeit. Diese Bewegung war hedonistisch und puritanisch, progressiv und regressiv, egalitär und elitär, modernistisch und kulturpessimistisch zugleich. Sie deklarierte sich antiautoritär und war doch entschieden autoritär. Sie war auf Individualisierung aus und frönte dem Kult der Gemeinschaft. Sie forderte Zärtlichkeit und Partnerschaft zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern und förderte erotische Segregation und emotionalen Autismus. Sie propagierte Autonomie und Selbstbestimmung und fetischisierte revolutionäre Organisation und Disziplin. Sie gab sich als Bewegung von Kriegsgegnern und schwelgte in den Perspektiven eines Weltrevolutionskrieges. Sie gebärdete sich radikal internationalistisch und ließ diskreten nationalen Ressentiments viel freien Raum. Sie rühmte sich ihres militanten Antifaschismus und fühlte sich bald schon ziemlich frei zum aggressiven "Antizionismus". Sie war schwärmerisch kosmopolitisch und zugleich provinziell bis lokalpatriotisch. Sie appellierte an imaginäre Massen und befleißigte sich exklusiver Geheimsprachen. Sie arbeitertümelte und volkstümelte heftigst und wahrte die Exklusivität der eigenen, geschlossenen Gruppen. (...)
Dass die produktive Rekonversion des größten Teils dieser linken Radikalismen und Militanzen des "roten Jahrzehnts" schließlich möglich war, kann man durchaus als einen (weiteren) Akt der Selbstzivilisierung dieser Gesellschaft sehen. Immerhin, es waren die Aktivisten dieses "roten Jahrzehnts" selbst, die nach und nach aus ihren selbstgewählten Kampfzonen, ihrer jeweiligen Sierra Madre, heruntergestiegen sind, um festzustellen, ob die Luft rein war. Jeder Schritt der "Anpassung" an die bürgerlichen Verhältnisse, wenn nicht gar des Eintritts in die "Normalität" (ein Schreckenswort!) war allerdings noch für lange Jahre mit Lebenslügen und Verbalradikalismen gepflastert. Aber heruntergestiegen sind sie am Ende doch.
Gerd Koenen: Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution. 1967 - 1977. Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt/Main 2007.
Es hat keinen Sinn, mir zu sagen, es wäre gescheiter, die ERFAHRUNG, diesen HASS, diese ENERGIE unverzüglich einzusetzen, um die Mine an die ganze Scheiße zu legen und die Kiste in die Luft zu jagen. Derartige Ratschläge selbsternannter Anführer gegen mir auf den Wecker. 'Unter diesen Umständen entschied ich mich für den einzig sicheren Weg - meinen eigenen.' (Andre sind da weiter als du. Der Fluch des 1. Koch'schen Gesetzes: Der Zweite wird nie der Erste werden.) (...) Ich weiß, dass ich verloren bin, wenn ich die Scheiße, die man mir vorsetzt, bedingungslos runterfresse. Man quatscht uns die Ohren voll. Ich selbst muss herausfinden, wer ich bin, was ich will, wo ich meine Kräfte einsetzen kann. (...)
Der AUFSTAND GESCHEITERT gegen diejenigen, die mich zur Sau gemacht haben, es ist kein blinder Haß, kein Drang, zurück ins Nirwana, vor die Geburt. Aber die Rebellion gegen die zwanzig Jahre im Elternhaus, gegen den Vater, die Manipulation, die Verfühung, die Vergeudung der Jugend, der Begeisterung, des Elams, der Hoffnung - da ich begriffen habe, daß es einmalig, nicht wiederholbar ist. Ich weiß nicht, wann es dämmerte, aber ich weiß, dass es jetzt Tag ist und die Zeit der Klarstellung. Denn wie ich sind wir alle betrogen worden, um unsere Träume, um Liebe, Geist, Heiterkeit, ums Ficken, um Hasch und Trip [werden weiter alle betrogen]. (...)
EINFACHER BERICHT: Mit dem 'Zusammenbruch' und dem 'Tod des Führers' ist das Ende nahe herangekommen. Der weiße Mann ist auf der Flucht. Ich saß beim Essen am großen Tisch neben meinem Vater. Mein Vater duldete keine Widerworte. Er hatte eine mächtige Stimme, wenn er schrie, tragen die Adern an seinen Schläfen stärker hervor als sonst. Als ein Eleve bei der Vorstellung ihm eine Zigarette anbot, warf er ihn hinaus. Als der Gewerkschaftssekretär Leuschner auf den Hof kam, wollte er die Hunde loslassen. Ich durfte bei Tisch mit den Beinen 'keinem Esel zu Grabe leuchen'. Ich saß zwanzig Jahre an diesem Tisch.
Der Sieg ist durch großangelegten, allgemeinen Verrat verspielt worden. Herr Otto Hahn rühmt sich, 'Hitler nichts gesagt' zu haben. Schneeketten trafen bei den deutschen Truppen in Griechenland ein, Tropenhelme an der Eismeerfront. Der Führer wusste von nichts, Bormann war sein böser Geist. Jetzt gilt es, so viel wie möglich zu bewahren und an die Jugend weiterzugeben. Die Morgenthauboys wollen aus Deutschland einen Kartoffelacker machen...
Bernward Vesper: Die Reise. Romanessay. Ausgabe letzter Hand. März-Verlag, Jossa 1979 (hier S. 15; 55; 142)
Es ist sonderbar, hier zu sein. Wir sind von Geheimnissen umgeben. Hinter unserer Erscheinung, unter unseren Worten, über unseren Gedanken, jenseits unseres Denkens wartet das Schweigen einer anderen Welt. In uns lebt eine Welt. Kein anderer kann uns nachricht von dieser Innenwelt überbringen. Jeder von uns ist ein Künstler. Durch die Öffnung des Mundes entlassen wir Laute aus dem Berg, der unter der Seele ruht. Diese Laute sind Wörter. Die Welt ist voller Wörter. Unentwegt sprechen Unzahlen von ihnen auf uns ein - laut, leise, in Zimmern, auf der Straße, im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen und in Büchern. Der Klang von Wörtern hält uns das, was wir die Welt nennen, zur Verfügung. Wir nehmen jeder des anderen Laute und bilden daraus Muster, Voraussagen, Segenssprüche und Blasphemien. Tagaus, tagein hält unser Sprach-Volk die Welt zusammen. Doch die Äußerung des Wortes offenbart, dass jeder von uns unermüdlich etwas erschafft. Jeder einzelne Mensch bringt Laute aus der Stille hervor und lockt das Universum in die Sichtbarkeit.
Wir Menschen sind Neuankömmlinge. Über uns tanzen die Galaxien in die Unendlichkeit hinaus. Unter unseren Füßen schlummert die uralte Erde. Wir sind aus ihrer ureigensten Substanz gebildet. Doch der kleinste Kieselstein ist Millionen von Jahren älter als wir. In unseren Gedanken sucht das Universum nach einem Widerhall.
Eine unbekannte Welt strebt nach Reflexion. Wörter sind halb abgewandte Spiegel, die unsere Gedanken beinhalten. Wir blicken auf diese Wort-Spiegel und erhaschen flüchtige Ahnungen von Sinn, Zugehörigkeit und Geborgenheit. Hinter den blanken Oberflächen unserer Wörter verbergen sich Dunkelheit und Stille. Wörter sind wie der Gott Janus: Sie blicken auswärts und einwärts zugleich.
John O'Donohue: Anam Cara - Das Buch der keltischen Weisheit. Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv), München 2018 (hier S. 13f.).
Veränderung ist im Grunde eine Verwandlung unserer eigenen inneren Wahrnehmungsstruktur. Wenn wir anders wahrnehmen, verändert sich die Welt um uns. Wir leben dann in einer anderen Welt, erleben andere Dinge und sind in der Lage, anders nach außen zu agieren. Die Verwandlung unseres inneren Wahrnehmungsporzesses bewirkt, dass wir uns anders fühlen. Unsere innere Struktur hat zuallererst damit zu tun, wir wir unseren Körper erleben, wie wir "eingekörpert" sind. Die Art, wie wir unseren Körper erleben und empfinden - und zwar besonders die vier großen Körperhöhlen - Kopf, Brustkorb, Bauchhöhle und Becken -, bestimmt die Art und Weise, wie wir die Welt erleben und empfinden.
(...)
In diesem Buch werde ich Methoden darstellen, die sich in der Praxis entwickelt und über die Jahre als nützlich und effektiv erwiesen haben. Zu diesen Ansätzen zählen zum Beispiel Wahrnehmungsübungen, die abgeleitet sind von Techniken aus der Traumaheilung. Andere Teile meines Ansatzes stammen aus der craniosacralen biodynamischen Arbeit, die zur Förderung tief nährender und nonverbaler Entwicklungs- und Wiederausrichtungsprozesse angewandt wird. Wieder andere stammen aus einer modifizierten Form der Aufstellungsarbeit, bei der anstelle von Familien- oder Organisationsgeschehen innere Prozesse dargestellt werden.
Weit bedeutsamer als das angewandte Verfahren ist jedoch die Handhabung der methodischen Seite. Als Begleiter dürfen wir den sich entfaltenden autonomen Prozessen nicht im Weg stehen, sondern müssen Hüter der inneren Räume und eines sicheren Prozessrahmens sein. (...) Unterbrechen, Bedrängen, Antreiben oder Besserwissen führt zu Störungen. Wir müssen verstehen, dass keine der angewandten Methoden "Techniken" sind! Sie verlangen alle nach einer besonderen Haltung des Begleiters, die zusammen mit dem Klienten und anderen Anwesenden heit heilendes Feld schafft. (...)
Unser Dilemma besteht darin, dass wir, abgesehen von der sehr technischen psychoanalytischen Theorie, über keine moderne Sprache verfügen, um innere Prozesse zu erklären und zu fördern. Es gibt in unserer Gesellschaft weder einen allgemeingültigen Rahmen noch ein kollektives Ritual zur Erleichtung individuellen Leidens oder zur Erarbeitung einer zusammenhängenden, stimmigen und sinnvollen Perspektive. Wir kennen kaum Wege, um mit Krisen, zwischenmenschlichen Konflikten, Zwiespältigkeit und Orientierungslosigkeit zurechtzukommen. ... Es ist entmutigend zu sehen, wie angeblich erfolgreiche Geschäftsleute, karriereorientierte Frauen, analytische Ingenieure oder kopfgesteuerte Menschen sich leicht in linearem Denken, emotionaler Überlastung, traumatisierten Selbstschutz-Konstruktionen oder undifferenzierten Sekundärmotivationen verirren. Es ist besorgniserregend zu erleben, wie schlecht die Menschen im Hier und Jetzt bleiben können und wie sie stattdessen von ihrer Vergangenhiet oder einer illusorischen, undefinierten Zukunft gesteuert werden, die sie kommen wird.
Es ist zwingend notwendig, die Herausforderung, wieder mit einer ganzheitlichen Navigation in Verbindung zu treten, anzunehmen. Diese Einsicht ist nicht unbedingt neu; der Jesuit und Philosoph Karl Rahner formulierte schon in den 60er-Jahren, der Christ der Zukunft werde entweder ein Mystiker oder überhaupt nicht sein - eine klare Aussage für einen weltlichen Menschen des 21. Jahrhunderts. Als Mystiker gelten dabei diejenigen, die durch ihre achtsame, unmittelbare Erfahrung und innere Klarheit gesteuert werden. Es sind die, die nicht auf einen angenommenen Messias oder Lehrer im Außen warten, sondern ihn heute in ihrem Inneren zum Leben erwecken. Für Msytiker hat diese unmittelbare, innere Realität mehr Autorität als das geschriebene Wort sakraler Texte.
Johannes B. Schmidt: Der Körper kennt den Weg. Trauma-Heilung und persönliche Transformation. Kösel-Verlag, München 2008 (hier S. 20-22; 30-31)
Die Konzepte der "Salutogenese", "Life Skills" und der "Lebensschule" verbindet der Gedanke, dass das Leben selbst, mit all seinen Herausforderungen, die auch Krisen einschließen, die beste "Schule" zum Erlernen konstruktiver Strateigien der Lebensbewältigung ist. Von Walter H. Lechler habe ich gelernt, dass letztlich alle Menschen, jeder auf seine Weise, um ihren "richtigen" Weg durchs Leben ringen, auch und gerade die Menschen, die wir aus pädagogischer Sicht für emotional und sozial inkompetent, für "auffällig", "süchtig" oder "krank" erachten. Erziehung unter dem Aspekt des Suchens und der Unterstützung der Kinder bei ihren Suchbewegungen zu betrachten, ebnet den Weg zum Dialog. In den Elternrunden geht es im Grunde immer wieder darum, die eigenen Erfahrungen im Meistern des Lebens mit anderen zu nutzen. (...)
Der Dialog ist ein Weg zu einer anderen Form des Miteinanders. Der Prozess des Dialogführens macht deutlich, wie unser Denken durch unsere Emotionen, Wünsche, Absichten, Unterstellungen und Ängste beeinflusst wird. Im Dialog ist Raum für das Aufspüren von Annahmen und Wertvorstellungen, die unserem Handeln zurgrunde liegen. Im Dialog mit anderen kommen wir zu uns selbst und erleben unsere Zugehörigkeit zu unseren Mitmenschen. Es geht um das Führen und Geschehenlassen von echten Gesprächen, oder, wie Martin Buber sagt, um "wahre Begegnung".
Johannes Schopp: Eltern Stärken. Die Dialogische Haltung in Seminar und Beratung. Ein Leitfaden für die Praxis. Verlag Barbara Budrich, Opladen und Farmington Hills, 2010 (hier S. 23f.; 25).
Es gibt sehr viele Dinge, die wir nicht erfolgreich tun können, wenn wir keinen vollen Zugang zu unserer Aggression haben und mit ihr nicht umgehen können. Eines davon ist, dass wir unsere persönlichen Grenzen nicht so ziehen können, dass andere sie respektieren. Unglücklicherweise gehört genau diese Fähigkeit zu den Schlüsselkompetenzen von Eltern, Erziehern, Lehrern und Pädagogen, ganz abgesehen davon, dass sie auch in Freund- und Partnerschaften unerlässlich ist. Der Mangel an persönlicher Autorität - vor allem im Umgang mit Kindern und Jugendlichen - ist zum Schicksal vieler Männer geworden, die beruflich mit ihnen arbeiten, doch sind auch viele Väter davon betroffen. (...)
Viele Jungen haben mit ihrer Aggression Probleme, weil ihre Väter entweder abwesend sind oder eher einen weiblichen Stil im Umgang mit ihren Söhnen pflegen. Sie kommt es, dass diese Jungen nie gelernt haben, ihre männliche Energie zu integrieren und sie in konstruktives Verhalten umzusetzen. Es ist schon fast eine brutal zu nennende Ironie, dass gerade diese Jungen von Frauen (Erzieherinnen, Lehrerinnen, Pädagoginnen) moralisch verurteilt und psychologisch stigmatisiert werden, anstatt ihnen mit traditionell weiblich konnotierten Tugenden wie Verständnis, Empathie, Mitgefühl und Fürsorge zu begegnen und ein aktiver, verantwortlicher Versuch gemacht wird, deren Väter zu mobilisieren.
Jesper Juul: Aggression. Warum sie für uns und unsere Kinder notwendig ist. S. Fischer-Verlag, Frankfurt am Main 2013 (hier S. 30f., 50).
Was haben Ihre Eltern von Ihnen erwartet? Wofür waren Sie emotional in Ihrer Familie verantwortlich? In welcher Weise haben Ihre Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder vorrangig behandelt? Welche grundlegenden Bedürfnisse der Kinder haben sie erfüllt und wie? Wieviel Raum hatten Sie, verschiedene Verhaltensweisen auszuprobieren? Wer in der Familie war für die Qualität der Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern verantwortlich? Wer musste dafür sorgen, dass Situationen sich verbesserten? Wer näherte wen?
Manchmal tragen wir als Erwachsene eine schwere emotionale Last. Dieses emotionale Gepäck enthält alle möglichen Dinge, die eigentlich nicht zu uns gehören, doch haben wir uns im Laufe der Jahre angewöhnt, sie mit uns herumzuschleppen - den Schmerz unserer Eltern, ihre Erwartungen, ihre Enttäuschungen, ihre Geheimnisse, ihren Zorn und ihre Verletzungen. Manchmal kann es uns schon mit Unzulänglichkeits- und Schuldgefühlen erfüllen, wenn wir nur darüber nachdenken, diese Last abzulegen. Wir sind dann emotional wie gelähmt und nicht in der Lage, uns zu bewegen. Wenn wir die Last ablegen würden, wären wir ein "schlechter" Sohn oder eine "schlechte" Tochter. "Wie konnten wir das nur tun?"
Wenn wir dann schließllich doch versuchen, die Last abzulegen und uns aus der Rolle zu befreien, die uns vor langer Zeit auferlegt wurde und die wir hauptsächlich aus Gewohnheit, Schuldgefühlen und Angst so lange gespielt haben, wenn wir uns weigern, uns weiterhin an die alten, stillschweigend vorausgesetzten emotionalen Regeln unserer Ursprungsfamilie zu halten, dann kann der Teufel los sein. Uns aus den alten und bequemen familiären Bezieungsmustern zu lösen und eine größere emotionale Unabhängigkeit zu entwickeln, kann als beispielloser Verrat aufgefasst werden. Oft rufen wir dadurch heftigen Widerstand und Kritik hervor. Es erfordert ungeheuren Mut und ebenso ebenso große Ausdauer, wenn wir in unserem Leben neue emotionale Muster entwickeln wollen. (...)
Vielleicht können wir uns deshalb von Zeit zu Zeit die Frage stellen, ob unsere Kinder hier sind, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, oder ob es umgekehrt ist. Und von welchem Zeitpunkt in ihrem Leben an akzeptieren wir, dass es nun in zunehmendem Maße ihre Sache ist, ihre Bedürfnisse zu erkennen und ihr Leben in die Hand zu nehmen?
Myla & Jon Kabat-Zinn: Mit Kindern wachsen. Die Praxis der Achtsamkeit in der Familie. Arbor-Verlag, Freiamt 2015 (hier S. 222).
Je besser der Kontakt eines Kindes zu sich selbst ist, umso leichter kann es lernen, harmonisch heranwachsen und sich entwickeln. Dass sich diese Frage - was es für ein Kind bedeutet, einen intensiveren und besseren Kontakt zu sich selbst zu haben - heutzutage überhaupt so dringend stellt, hat sowohl positive als auch durchaus problematische Aspekte. Gut finden wir, dass eine autoritäre Erziehung weitestgehend aus der Erziehungspraxis verschwunden ist, denn sie hatte als einziges Ziel, Kinder und Erwachsene in ein hierarchisches System zu zwingen, dessen Wurzeln bis in die Zeit des Absolutismus zurückreichen... Doch leider brachte diese Auflösung überholter hierarchischer pädagogischer Ansichten - und jetzt kommen wir zum problematischen Aspekt - mit sich, dass wir uns zunehmend in einer Art luftleerem Raum befinden. (...)
Wir Erwachsene haben nicht mehr automatisch recht, nur weil wir Erwachsene sind. Unsere Kinder sind in der Lage, alles zu hinterfragen, auch unsere Autorität als Eltern. Das Zusammenleben von Kindern und Eltern findet in einer Offenheit statt, die aber nicht definiert ist. Das Vielversprechende an dieser Offenheit sind die neuen Möglichkeiten, echte Gleichwürdigkeit und Wärme in den Beziehungen entstehen zu lassen. Die Gefahr besteht darin, dass der äußere Rahmen diesen Prozess nicht stützen kann und dass das Fehlen von festen Richtlinien ein Gefühl von Angst und Chaos auslösen kann. Aus unseren jeweiligen fachlichen Überlegungen haben wir geschlossen, dass es vor allem darum geht, wie wir Menschen dazu kommen, in uns selbst zu ruhen, was bedeutet, im eigenen Wesenskern zu ruhen, sich seiner selbst auch gefühlsmäßig sicher zu sein. Denn nur wer sicher in sich selbst ruht, ist in der Lage, zu anderen menschen ein tiefer gehendes Verhältnis zu entwickeln. Solche Selbstsicherheit basiert auf einer Reihe angeborener Kompetenzen. Darum hilft man einem kind nicht dabei, größeren inneren Halt zu entwickeln, indem man ihm immer nur etwas Neues beibringt. Man hilft ihm, indem man es darin unterstützt, dass es nicht verliert, was es doch von Beginn an mitgebracht hat.
Jesper Juul und Peter Hoeg: Miteinander. Wie Empathie Kinder stark macht. Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 2012 (hier S.26;27-28).
Der Hauptunterschied der aktiven Methode besteht darin, dass für uns das Hauptanliegen der Erziehung nicht darin besteht, wie man einem Individuum wissenswerte Inhalte möglichst schnell und schmerzlos einflössen kann. Uns geht es vor allem darum, wie Kinder und junge Menschen in eine sich schnell wandelnde Welt so hineinwachsen, dass ihr Sein und damit ihre Fähigkeiten zu einer positiven Anpassung an neue Lebensumstände durch den Erziehungsprozess nicht geschwächt, sondern vielmehr gestärkt werden.
Die aktive Schule setzt an die Stelle eines allgemein verbindlichen festen Lehrplans die systematische Pflege von erneuerungsfähigen Lernprozessen. Sie will vermeiden, in den Kindern die Illusion zu schaffen, dass Bildung etwas sei, das man in verschiedenen "Stufen" abschliessen kann, wodurch man es dann vorläufig 'geschafft' hat."
Rebecca Wild: Erziehung zum Sein. Erfahrungsgeschichgte einer aktiven Schule. Arbor-Verlag, Freiamt 1998.
Früher musste ich mich oft fragen, ob es uns jemals möglich sein wird, das volle Ausmaß der Einsamkeit und Verlassenheit zu erfassen, dem wir als Kinder ausgesetzt waren. Inzwischen weiß ich, dass dies möglich ist. (...)
Die frühe Anpassung des Säuglings führt dazu, daß die Bedürfnisse des Kindes nach Liebe, Achtung, Echo, Verständnis, Teilnahme, Spiegelung verdrängt werden müssen. Gleiches gilt für die Gefühlsreaktionen auf die schwerwiegenden Versagungen, was dazu führt, daß bestimmte eigene Gefühle (wie z.B. Eifersucht, Neid, Zorn, Verlassenheit, Ohnmacht, Angst) in der Kindheit und dann im Erwachsenenalter nicht erlebt werden können. Dies ist umso tragischer, als es sich hier um Menschen handelt, die an sich zu differenzierten Gefühlen fäig sind. (...)
Es gehört zu den Wendepunkten der Therapie, wenn Menschen zu der emotionalen Einsicht kommen, daß all die "Liebe", die sie sich mit soviel Anstrengungen und Selbstaufgabe erobert haben, gar nicht dem galt, der sie in Wirklichkeit waren; daß die Bewunderung für ihre Schönheit und Leistungen der Schönheit und den Leistungen galt und nicht eigentlich dem Kind, wie es war. Hinter der Leistung erwacht in der Therapie das kleine einsame Kind und fragt sich: "Wie wäre es, wenn ich böse, häßlich, zornig, eiferfüchtig, verwirrt vor euch gestanden hätte? Wo wäre dann eure Liebe gewesen? Und all das war ich doch auch. Will das heißen, dass eigentlich nicht ich geliebt wurde, sondern das, was ich vorgab zu sein? Das anständige, zuverlässige, einfühlsame, verständnisvolle, das bequeme Kind, das im Grunde gar nicht Kind war?
Alice Miller, Das Drama des begabten Kindes. Eine Um- und Fortschreibung. Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1997 (hier S. 22;30).
Leider zählt innerhalb unseres konventionellen Werte- und Normensystems nicht, wer wir in unseren Gefühlen sind, sondern lediglich das, was wir auf "erfolgreichen" Laufbahnen erreichen. Danach werden wir gemessen; danach beurteilen wir uns auch selbst. Erfolg ist der Maßstab, an dem der Mann gemessen wird, nicht seine Fähigkeit zu lachen, zu spielen oder zärtlich zu sein. Aber dieser Erfolg gründet letztlich auf dem Versagen eines anderen. Diese Lektion fängt im Elternhaus an, wird in der Schule verstärkt, so daß wir dann mit dem Erwachsensein von einem internalisierten Alptraum gezeichnet sind: Um in unserer Kultur erfolgreich zu sein, mußt du lernen, vom Versagen zu träumen. Der amerikanische Soziologe Jules Henry dokumentiert diesen Vorgang mit Schärfe und Schmerz in seinem Buch Culture Against Man (Die Kultur gegen den Menschen, 1963).
Das trifft Frauen und Männer gleichermaßen, aber mit einem Unterschied. In unserer Kultur haben die meisten Männer keine Chance, der Notwendigkeit zu entweichen, ein Sein aufzubauen, das nicht von der Metaphysik des Erfolgs und der Leistung bestimmt wird. Und da sie uns zu einem scheinbar adäquaten Gefühlsbereich verhilft, wird sie zu unserem Bedürfnis. Für Frauen jedoch bietet sich eine andere Möglichkeit in ihrer Entwicklung. Indem es fast von Geburt an zum zentralen Thema für sie werden kann, ein potentieller Träger des Lebens zu sein, kann dieses reale Ziel der Entstehung eines Lebewesens – und damit der Möglichkeit, es offen zu genießen, an seinen Schmerzen, Leiden, Freuden und Ekstasen teilzunehmen – zum zentralen Punkt des eigenen Leitbildes werden. Auf diesem Weg können Gefühle, die mit realem Leben verbunden sind, zu einem Sinn des eigenen Seins beitragen, der nicht auf Abstraktionen beruht.
Arno Gruen: Der Varrat am Selbst. Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau. dtv, München 2018.
Konflikte und Körpergefühle im täglichen Leben, vor allem in der Interaktion mit dem Partner oder der Partnerin, und oft auch Krankheiten und Unfälle tragen eine versteckte Botschaft in sich. Sie sind unbewusste Versuche, verdrängte oder vergessene traumatische, oft lebensbedrohlich empfundene Verletzungen und die damit verbundenen Gefühle aus der vorsprachlichen Kindheit, der Geburt oder der vorgeburtlichen Phase im Mutterleib wiederherzustellen und bewusstwerden zu lassen. Diese Botschaften werden, sofern sie nicht wegrationalisiert werden, zu verlässlichen Führern. Durch sie wird es möglich, eine Rückverbindung zu nicht gelebten Emotionen und vergessenen Verletzungen der frühesten Kindheit zu finden. Das ist ein erster Schritt zur Heilung.
Willi Maurer: Der erste Augenblick des Lebens. Der Einfluss der Geburt auf die Heilung von Mensch und Erde. Drachen Verlag GmbH, Klein Jasedow 2009 (hier S. 108)
Wie kann geschehen, was geschehen muss? Denn es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass etwas getan werden muss. Man weiß ja, dass das 21. Jahrhundert turmhohe Gefährdungen bereithält: Weltweit verändert sich das Klima, Schuldenberge lassen wirtschaftliches Wachstum zum Trugbild werden, allerorten öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich. Auf Regierungsebene hingegen ist Verdrängung Trumpf, nirgendwo hat man das Gefühl, dass die tonangebenden Klassen die Zeichen der Zeit erkannt haben. Doch der Wandel, schleichend und subversiv, ist im Gang. Er wartet nicht auf Parteitagsbeschlüsse und EU-Richtlinien, er greift Platz durch große wie kleine Initiativen vielerorts in der Gesellschaft. (...) Zwar haben Minderheiten nicht die Macht, aber sie haben Einfluss. Sie reagieren früh auf sich anbahnende Umbrücke, sie verkörpern neue Sensibilitäten, sie bringen dringende Forderungen zur Sprache und realisieren neue Lösungen. So hat in den letzten Jahrzehnten eine "Bewegung ohne Namen" (Paul Hawken) Aufschwung genommen, vom Biolandbau zum Fairhandel, von Null-Energie-Häusern zur Solarindustrie, von Stadtteil-Initiativen zu internationalen Netzwerken für sozial verantwortliche Forschung. Die Bewegung ohne Namen hat keinen Kopf und kein Zentrum, aber sie ist vielgestaltig und global. (...)
Hildegard Kurt und Shelley Sachs beleuchten diesen Transformationsprozess von einem ungewöhnlichen Blickwinkel aus. Sie interessieren sich kaum für Ziele und Ergebnisse von Initiativen, welche die Zukunftsfähigkeit zum Programm gemacht haben. Es geht ihnen vielmehr um eine Aufgebung der Grenze zwischen innerer und äußerer Arbeit. Ein wichtiger Beitrag dieses Buches ist, dass der oftmals stark nach außen gerichtete Blick vieler Nachhaltigkeitsinitiativen um den inneren Raum erweitert wird. Denn darüber darf man sich nicht hinwegtäuschen: Die Projektplanung und -durchführung ist die eine Sache, der Binnenbereich der Gedanken, Gefühle und Entschlusskräfte die andere.
Shelley Sachs und Hildegard Kurt: Die rote Blume. Ästehtische Praxis in Zeiten des Wandels. Mit einem Vorwort von Wolfgang Sachs. thinkoya, Drachen-Verlag, Klein Jasedow 2013. (hier S. 9f.: Vorwort)
Die drei Autoren des Buches – Cordelia Stillke, Christian Schneider,
Bernd Leineweber – sind sich der im Generationsbegriff versteckten Fallen wohl bewusst. Im Unterschied zu Heinz Bude, für den sich Generationszugehörigkeit und biographischer Ablauf quasi mechanisch
gegenseitig bedingen, konzentrieren sie sich auf die Übergänge zwischen und innerhalb von Generationen. Was sie »Generationengeschichte« nennen, will die Prozesse untersuchen, „in denen zwischen den Generationen der Umgang mit einem
bestimmten geschichtlichen Erbe ausgehandelt wird.“
Das Erbe, um das es geht, ist freilich nicht aus einem Stück; der Buchtitel »Trauma und Kritik« deutet es an. Wessen Trauma und
wessen Kritik?
Als Max Horkheimer und Theodor W. Adorno aus dem amerikanischen Exil nach Deutschland zurückkehrten, trafen sie ihrerseits auf eine
traumatisierte junge Generation, die sich als nur zufällig dem Massenmord Entkommene verstand, die eben vom Entkommen traumatisiert wurde. Die deutschen Studenten jedoch waren anders traumatisiert,
als Kinder der Täter. Wie kam es über den Graben der Tat hinweg zum produktiven Austausch zwischen diesen Lehrern und ihren Schülern, wie konnte das Motiv der »Überlebensschuld«, von der Adorno
sprach, mit der Bewusstmachung der Täterschuld eine Verbindung eingehen? Auf diese und andere damit zusammenhängende Fragen geben Stillke, Schneider und Leineweber außerordentlich differenzierte und
anregende Antworten. Ihr Buch »Trauma und Kritik« liefert Aufklärung im besten Sinne über die Geschichte jener allmählich in den Bereich positiver oder negativer Mythologie hinweggleitenden
Kritischen Theorie im Nachkriegsdeutschland.
Als eine der »faszinierendsten Wirkungsgeschichten einer philosophischen Richtung« im 20. Jahrhundert betrachten die Autoren die
Rezeption der Schriften Max Horkheimers und mehr noch derjenigen Adornos. In dieser Einschätzung ist ihnen schwer zu widersprechen. Diese Wirkungsgeschichte verdankt sich jedoch, vermögen sie zu
zeigen, einer Serie von Missverständnissen, beginnend mit dem Umstand, dass die aus einer Art »Intellektuellenverschwörung« hervorgegangene Kritische Theorie sich bei ihrer Rückkehr aus dem Exil
aufgefordert sah, ganz gegen ihre ursprüngliche Konzeption pädagogisch zu werden. Eine »widerstandsfähige Jugend heranziehen«, wollte der an die Frankfurter Universität berufene Max Horkheimer,
während seinem geistigen Mitstreiter Adorno nichts ferner lag als Erziehung und Didaktik. Nach Horkheimers Emeritierung im Jahr 1961 ruhte die Last der Lehre in Frankfurt am Main allein auf den
Schultern des Antipädagogen Adorno. Lehrer waren für Adorno, wie aus mehreren seiner Texte hervorgeht, stets Horrorfiguren gewesen, fast im gleichen Assoziationsfeld wie KZ-Schergen angesiedelt. Wie
konnte nun aus dem als schwierig bis vertrackt esoterisch verschrieenen Denker und Schriftsteller Adorno ein Universitätslehrer werden, der in den sechziger Jahren einige der hellsten Köpfe unter den
damals in Westdeutschland Studierenden anzog? Es lag nicht nur am Novum der vorgetragenen dialektischen Gesellschaftstheorie, es lag auch, schreibt das Autorentrio mit überzeugenden Argumenten, an
der physiognomischen Ausstrahlung Adornos, des einstigen Schülers von Alban Berg:
„Adorno als Lehrer im herkömmlichen Sinn war ein
lebendes Missverständnis. Dass er, trotzdem oder gerade deshalb, in einer spezifischen historischen Situation eine mächtige Lehr- und Identifikationsgestalt werden konnte, hängt unmittelbar damit
zusammen, dass er wie kein zweiter die radikalste aller biographischen Weigerungen verkörperte, den Wunsch, ‚kein Erwachsener zu werden‘.“
Solche Wunschverkörperung schuf eine einmalige, von den Autoren des Buchs mit Empathie, aber nicht kritiklos dargestellte Affinität
zwischen diesem unmöglichen Lehrer und seinen zwischen Adoleszenz und Erwachsenenalter flottierenden Studenten. Sie zeigte sich aber auch in der Art der Vermittlung theoretischen Denkens. Aufklärung
des Unaufgeklärten blieb das Ziel, doch eingedenk des Diktums Nietzsches, dass die Zerstörung einer Illusion allein noch keine »Wahrheit ergibt«, sondern nur »unsere Öde« vergrößert, bot Adorno in
seiner Lehre zusammen mit Aufklärung neue Verrätselung an. Daraus entstand ein Faszinosum, das in der Geistesgeschichte der Nachkriegsjahrzehnte in Deutschland ohne Beispiel
blieb.
Lothar Baier im Deutschlandfunk (2001): https://www.deutschlandfunk.de/leineweber-schneider-stillke-trauma-oder-kritik.730.de.html?dram:article_id=101541.
Christian Schneider, Cordelia Stillke, Bernd Leineweber: Trauma und Kritik. Zur Generationengeschichte der Kritischen Theorie. Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2009.
Die zweite Generation der Shoah – ein psychoanalytischer Forschungsansatz Die vergangene Wirklichkeit, obwohl vergangen, ist in keiner Weise abgeschlossen, sondern wirkt in die aktuelle Situation der Gegenwart bis in die Zukunft zutiefst prägend hinein. Diese Prägung vollzieht sich zumeist ohne das Bewusstsein der Betroffenen, die diese stille Einwirkung in ihre Wirklichkeit und deren Bedeutung nicht erfassen können. Genauso entzieht sich das Bild der Vergangenheit dem menschlichen Verstehen und kann niemals in seiner Objektivität und der Bedeutung ihres gewesenen So-Seins verstanden werden. Ihr Bild hängt stets von der gegenwärtigen Situation, mit ihren aktuellen Perspektiven und Interessen, sowie den zukünftigen Erwartungen ab. Somit ist das Vergangene ständig als etwas Unverfügbares präsent und psychosozial wirksam. Die Psychoanalytiker Jürgen Straub und Kurt Grünberg sprechen daher vom Status der „unverlierbaren Zeit“ der Vergangenheit, da diese „sich aus eigener Kraft fort[setzt], im Leben des einzelnen so gut wie in der sozialen Praxis. Sie bestimm[t] die persönliche Verfassung von Individuen und die kollektive Praxis womöglich über Generationen hinweg.“ Die neuere psychoanalytische Forschung setzt sich mit dieser Wirkkraft der vergangenen Wirklichkeiten auseinander, wobei ihr Hauptaugenmerk auf den psychosozialen Wirkungen vergangener Traumata liegt. Ihren Ausgang nimmt die Forschung dabei in der Annahme, dass geschichtliche Wirklichkeiten und Erfahrungen „eine eigene, sich in die Leiblichkeit, Subjektivität und Sozialität von Menschen einschreibende Kraft“ besitzen und sich daher auch jenseits ihrer tatsächlichen zeitlichen Wirklichkeit unmerklich und unbewusst über mehrere Generationen hinweg fortsetzen und deren Leben und Identität entscheidend beeinflussen können. Es ist demnach nicht von Bedeutung, ob vergangene Erfahrungen bewusst erinnert, reflektiert und der kommenden Generation explizit berichtet werden, oder nicht. Durch diese eigentümliche, einschreibende Kraft ist die Vergangenheit in die Körper der betroffenen Menschen, in deren Verhalten und soziale Praktiken sowie in deren Gestik und Mimik eingebrannt und bestimmt diese. So kann die Vergangenheit als Gegenwärtiges und Prägendes auch nicht intentional und völlig unbewusst ihre Wirkung entfalten.
Die Psychoanalytikerin Gertrud Hardtmann bezweifelt allerdings, dass die bisherige psychoanalytische Theorie diese Wirkungsmacht von vergangenen Ereignissen konzeptuell erfasse. Sie stellt vielmehr die Frage danach, ob die psychoanalytische Theorie nicht erweitert werden müsste, um das Phänomen, dass sich durch soziale Erfahrungen Spuren vergangener Ereignisse in der individuellen Psyche auch über mehrere Generationen hinweg finden lassen, erläutern zu können. Vor allem traumatische Erfahrungen besitzen eine ansteckende Wirkungsmacht, da diese extremen Ereignisse meist von den Betroffenen ausgeblendet und völlig unverarbeitet aus ihrem Gedächtnis verdrängt wurden, ohne allerdings ihren Einfluss auf die Psyche der Menschen zu verlieren. Das Trauma ist demnach als etwas Unverfügbares präsent und psychosozial wirksam, wie dies Straub und Grünberg anhand der „unverlierbaren Zeit“ beschreiben. Die psychoanalytische Definition vom Trauma bezeichnet lediglich, dass ein Trauma ein Ereignis sei, das zu einer schockartigen Reizüberflutung führe, die die menschliche Seele nicht verkraften kann. Alle erlernten und gewohnten Verarbeitungsmechanismen zur Bewältigung erweisen sich in diesem Moment als ungeeignet und aufgrund dieser Überwältigung der psychischen Verfasstheit wird das traumatische Ereignis unverarbeitet verdrängt und ausgeblendet. Diese Definition von Trauma erweist sich allerdings als unzulänglich, da hier lediglich die Traumatisierung der direkt Betroffenen beschrieben wird, jedoch die darauf folgende psychosoziale Wirksamkeit dieses Ereignisses völlig außen vor gelassen wird.
Anna-Maria Post: Die „unverlierbare Zeit“. Sergio Chejfecs Lenta biografía und die zweite Generation der Shoah (file:///C:/Users/Johannes%20Höffling/Downloads/9139-Artikeltext-9363-1-10-20110923.pdf).
Kurt Grünberg und Jürgen Straub (Hrsg.): Unverlierbare Zeit. Psychosoziale Spätfolgen des Nationalsozialismus bei Nachkommen von Opfern und Tätern. Brandes & Aspel, Frankfurt am Main 2001.
Zur Neuausgabe schrieben die Verfasser im Jahre 1969:
Die 'Dialektik der Aufklärung' ist 1947 bei Querido in Amsterdam erschienen. Das Buch, das erst allmählich sich verbreitete, ist seit geraumer Zeit vergriffen. Wenn wir den Band nach mehr als zwanzig Jahren jetzt wieder herausbringen, so bewegt uns nicht allein vielfaches Drängen, sondern die Vorstellung, daß nicht wenige der Gedanken auch heute noch an der Zeit sind und unsere späteren theoretischen Bemühungen weitgehend bestimmt haben. Kein Außenstehender wird leicht sich vorstellen, in welchem Maß wir beide für jeden Satz verantwortlich sind. Große Abschnitte haben wir zusammen diktiert; die Spannung der beiden geistigen Temperamente, die in der 'Dialektik' sich verbanden, ist deren Lebenselement. Nicht an allem, was in dem Buch gesagt ist, halten wir unverändert fest. Das wäre unvereinbar mit einer Theorie, welche der Wahrheit einen Zeitkern zuspricht, anstatt sie als Unveränderliches der geschichtlichen Bewegung entgegenzusetzen. Das Buch wurde in einem Augenblick verfaßt, in dem das Ende des nationalsozialistischen Terrors absehbar war. An nicht wenigen Stellen jedoch ist die Formulierung der Realität von heute nicht mehr angemessen. Indessen haben wir den Übergang zur verwalteten Welt schon damals nicht zu harmlos eingeschätzt. In der Periode der politischen Spaltung in übergroße Blöcke, die objektiv dazu gedrängt werden, aufeinander zu prallen, hat das Grauen sich fortgesetzt. Die Konflikte in der Dritten Welt, das erneute Anwachsen des Totalitarismus sind so wenig nur historische Zwischenfälle, wie, der 'Dialektik' zufolge, der damalige Faschismus es war.
Kritisches Denken, das auch vor dem Fortschritt nicht innehält, verlangt heute Parteinahme für die Residuen von Freiheit, für Tendenzen zur realen Humanität, selbst wenn sie angesichts des großen historischen Zuges ohnmächtig scheinen. Die in dem Buch erkannte Entwicklung zur totalen Integration ist unterbrochen, nicht abgebrochen; sie droht, über Diktaturen und Kriege sich zu vollziehen. Die Prognose des damit verbundenen Umschlags von Aufklärung in Positivismus, den Mythos dessen, was der Fall ist, schließlich die Identität von Intelligenz und Geistfeindschaft hat überwältigend sich bestätigt. Unsere Konzeption der Geschichte wähnt nicht, ihr enthoben zu sein, aber sie jagt nicht positivistisch nach Information. Als Kritik von Philosophie will sie Philosophie nicht preisgeben. Aus Amerika, wo das Buch geschrieben ist, kehrten in der Überzeugung wir nach Deutschland zurück, theoretisch wie praktisch mehr tun zu können als anderswo. Zusammen mit Friedrich Pollock, dem das Buch, wie seinerzeit zum fünfzigsten so heute zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag, gewidmet ist, haben wir das Institut für Sozialforschung in dem Gedanken wieder aufgebaut, die in der 'Dialektik' formulierte Konzeption weiterzutreiben.
Frankfurt am Main, April 1969 Max Horkheimer Theodor W. Adorno.
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente. Fischer-Verlag, Frankfurt am Main 2019.